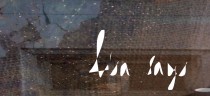I
draußen, vor der tür
Das Treppenhaus ist ein Ort, den es nicht gibt. Er ist eine Station, wo nichts hält. Es wird ausgeblendet, verschwiegen, verdrängt. Ein Ort, an dem nichts geschieht und nichts geschehen ist. Nicht existent, wie jeder, der sich hinein begibt.
Am Anfang ging die Tür immer sehr schwer. Man musste sich dagegenstemmen, auflehnen gegen sie mit aller Macht und Kraft, um danach erschöpft in sie hineinzustürzen. Heute fällt sie fast auf, ganz leicht. Ihr Widerstand ist gebrochen, die Jugend vorbei, geregeltes Mittelmaß mit dem Hang nachzugeben, bevor überhaupt jemand kommt. Unsere Tür ist ein ehemaliger Rebell. Kaputtes Wesen. Die verkörperte Tragik der Dinge. Ein Schicksal unter vielen. Man muss sie hinter sich schließen, von allein fällt sie nicht ins Schloss. Apathisch steht sie meistens offen. Niemand kümmert sich um sie, einfach ein Hindernis weniger, ein kleines Detail, das untergeht. Ihr gebrochener Wille ist eine willkommene Erleichterung, es ist nicht mehr nötig, die Tür aufzuschließen oder auch nur die Klinke zu betätigen. Es ist, als wäre sie einfach nicht da. Sie macht sich unsichtbar, passt sich an, jedoch nicht den anderen Türen, sondern dem Willen ihrer Benutzer. Denn wer hat schon noch Zeit, eine Tür zu öffnen. Drehtüren, Schiebetüren, Drehkreuze, Fahrstuhltüren, Supermarkttüren – von allein aufschwingende Türen. Sie ist hinterher. Doch ihr fehlt deshalb auch der Mechanismus. Sie kann sich auf nichts anderes verlassen, als auf sich selbst. Sie erwartet gesteuert zu werden, wie alle anderen, aber kein Bewegungssensor nimmt sich ihrer an. Und deshalb schaukelt sie nur ziellos in ihrem Rahmen, verwirrt, verbittert, ausgeleiert.
Sie ist ein Opfer und ein Täter unserer Zeit, die wir nicht haben.
Das Treppenhaus lässt keinerlei Anzeichen auf Benutzung erkennen. Es riecht stets frisch wie am ersten Tag, fremd wie am ersten Tag, unmenschlich wie am ersten Tag, es riecht nach der Verwesung des Stillstands. Kein Leben, der süßlicher Zitrusduft wie man ihn sonst nur in Hotels und fremden Wohnungen wahrnimmt, hatte es vertrieben. Und die Bewohner gaben sich keine Mühe dies zu ändern, vielleicht bemerkten sie es nicht einmal. Keine Spuren zu hinterlassen, heißt, nicht da zu sein, nie da gewesen zu sein, nicht zu existieren, faktisch tot zu sein. Es war egal. Es war den Rentnern egal. Es war der jungen Frau und ihrem kleinem Kind egal. Es war Herrn Pohl egal. Seinem kleinen Kläffer war es nicht egal, aber er konnte nichts anderes tun, als jeden Morgen um die gleiche Zeit erbärmlich zu jaulen. Das war alles. Sonst Stille. Man ist einander nie begegnet. Die Namen an den Klingelschildern lösen nichts aus. Bitte halten sie Abstand, um die Diskretion zu wahren. Maier. Müller. Hoffmann. Pohl. Aneinandergereihte Buchstaben in verschiedenen Etagen. Natürlich gibt es Erzählungen. Spekulationen. Gerüchte. Sie sind Phantome, gerade so interessant, dass man um ihr Dasein weiß, ohne die Last auf sich zu nehmen, zu forschen, ob es sie wirklich gibt. Es ist egal. Wir Leben aneinander vorbei, in dankbarer Anonymität. Keine Belastungen. Kein lästiges Grüßen. Keine falsche Freundlichkeit, kein aufgesetztes Interesse. Eine Bürde weniger.
Irgendwann doch eine Last, man wird sich voreinander verstecken, Angst, die eingelebte Ordnung zu stören.
Betritt man es endgültig, so ist man genötigt, die Tür hinter sich zu schließen. Man fühlt sich beobachtet, die sonst lässige Unachtsamkeit verwandelt sich unter mechanischen Augen zur größten Penibilität. Es ist niemand da, es riecht als wäre nie jemand da gewesen, verstörend neu. Und genau dies ist es, was verwirrt und einem das Gefühl gibt, dass etwas nicht stimmt. Dass man beobachtet wird. Es ist niemand da. Stille. Versuche, die Tür unsäglich leise zu schließen, es klingt wie ein Donnern. Auf dem Weg nach oben gibt es nicht viel zu sehen. Die sonst üblichen ausgemusterten Grünpflanzen, die sonst auf jedem Absatz jeder Plattenbaute zu finden sind, fehlen. Keine Schuhe vor den Türen. Keine Namensschilder aus Messing, sonder solche aus Plaste, die neben der Tür hängen und alle gleich aussehen. Das gesprenkelte Grau des Linoleums wirkt klinisch desinfiziert. Die Fußmatten darauf sind alle alte Bekannte, jede hat man schon einmal irgendwo gesehen, bei Aldi, bei Ikea, wer weiß das schon. Man hat keine andere Wahl, als auf den Fußboden zu starren, die Wände sind weiß und bedrohlich, zwingen, den Blick abzuwenden, Demut, Unterlegenheit, Ekel. Einzig das Licht strahlt eine gewisse Wärme aus. Steigt man höher, wird es immer kälter. Es fängt an zu flackern. Nicht oft oder schnell hintereinander, sondern für gefühlte Sekunden. Es ist kein Blitz mehr sondern erzeugt das Gefühl, ungewöhnlich lange geblinzelt zu haben, ein kurzer Schlaf, eine Ohnmacht, eine vorübergehende akute Blindheit.
Wenn das Licht unerträglich kalt geworden ist, bin ich zu Hause.
Das Treppenhaus ist ein Ort, den es nicht gibt. Er ist eine Station, wo nichts hält. Es wird ausgeblendet, verschwiegen, verdrängt. Ein Ort, an dem nichts geschieht und nichts geschehen ist. Nicht existent, wie jeder, der sich hinein begibt
II
sie, die beiden
Die beiden unterschieden sich nicht durch viel. Sie waren klein, hatten den gleichen sturzelenden Kurzhaarschnitt in dem spärlich wachsenden undefinierbaren Braun, trugen ähnliche goldumrandete dicke Brillen, jeder mit einer dieser Kordeln am Bügel befestigt, die Gestelle am Herunterfallen hindern sollen und von Billigmärkten noch immer als eine Revolution in der Geschichte des Sehhilfenschutzes angepriesen werden.
Nur war er etwas runder und sie hatte bemerkenswert schiefe Schneidezähne, die beständig zu sehen waren und die einen Blickfang an der überfüllten Haltestelle darstellten, wenn nicht gar den Höhepunkt der ganzen Straßenbahnfahrt, nicht amüsant aber doch faszinierend.
In früheren Zeiten wären sie vielleicht Bauern gewesen, heute waren sie irgendetwas. Wer kann schon noch sagen, was jemand tut. Sie waren jedenfalls tadellos anständig, leise, sauber. Und doch hätten sie den Geruch des Unerhörten, des Schmutzes, des Ekels verströmt, wäre nicht auch der Großteil der anderen ihnen ähnlich, wenn nicht gar gleich gewesen. Sie waren weder alt noch krank und doch reihten sie sich mühelos in diese Schublade ein, sie gehörten zu denen, die man besser nicht beachtet, weil sie es einfacher haben, weil sie einfacher sind, weil sie verschwinden in der Masse. Und doch immer, wenn man sie sich genauer ansieht, wen auch immer, dann fängt man an nachzudenken, sieht ihr Elend und ihr Leid, das sie selbst nicht einmal zu bemerken scheinen. Man fühlt mit, was sie nie gespürt haben. Es ist sinnlos, es gibt zu viele von ihnen und man kann ja doch nichts ändern. Nur für einen selbst ist es eine ungemeine Erleichterung, Befriedigung und Erhebung, diese Menschen zu betrachten, weil man merklich über ihnen steht, sie beurteilen kann, man weiß mehr über sie als sie selbst über sich. Es ist erbärmlich, beiderseits. Der eine merkt nicht, wie er beurteilt wird, der andere merkt nicht, wie er durch die Beurteilung seine eigene Überlegenheit aufgibt, die hohen Ideale, weder selbstherrlich noch selbstsüchtig zu agieren, und doch. Wir sind alle gleich. Sind wir alle gleich?
Die beiden trugen jeden Tag dieselben Sachen, dicke glänzende Anoraks aus einem Discounter, er in blau, sie in orange, weiße Kunstlederschuhe bestickt mit silbernen Motiven, die wohl chinesische Schriftzeichen darstellen sollten, und unförmige Jeans in undefinierbarer Länge, weder zu kurz noch zu lang, aber auch nicht so wie sie sein sollten. Trotz des täglichen Gebrauchs wirkten sie nie schmutzig, sondern nur abgetragen, so wie wenn man etwas sehr gern trägt, auch wenn in diesem Fall wohl eher ein resignierender Pragmatismus den Anlass gegeben haben möge. Sie wirkten nicht wie Menschen, die sich sehr an schönen Dingen erfreuen können. Was bei uns ästhetisch heißt, ist bei ihnen unnütz. Die Monotonie jedoch schien ihrem Leben halt zu geben. Was bei uns schon längst Langeweile auslösen würde, war bei ihnen eine willkommene Abgestumpftheit, ob angeboren oder erworben ist letztendlich egal. Alles was sie taten, wirkte eigenartig mechanisch. An der Haltestelle belegten sie immer dieselbe Stelle, in der Bahn suchte er ihr einen Sitzplatz und während er stand saß sie da, die Hände ordentlich im Schoß gefaltet. Ihre Beine standen immer parallel nebeneinander.
Nur manchmal durchbrochen sie alle Gewohnheit, sowohl ihre als auch die Sehgewohnheit aller Umstehenden. Dann beugte er sich über sie und gab ihr einen Kuss, während sie verschämt auswich und nach den anderen schielte. Seinem Kuss konnte sie jedoch nie entkommen, und danach strahlten die beiden immer eine Art Dankbarkeit aus. Es war keine Leidenschaft, ihre Zuneigungen waren grob und einfach wie sie, und doch löste es jedes Mal etwas in einem aus. Sie taten etwas, das sonst niemand ihrer Art getan hatte und lösten damit einen Riegel im innern. Etwas stimmte nicht, etwas war hier falsch gelaufen, etwas war nicht, wie es immer war. Die eigenen Monotonien und Gewohnheiten waren nun verletzt worden durch diese beiden. Und umso abstoßender desto ehrlicher wirkten sie. Ehrlicher und echter als alle anderen, als alles andere. Ich konnte meinen Blick nicht von ihnen lassen und vielleicht war es auch ein ungewohntes Gefühl in diesem Zusammenhang: Neid.
III
er, .
Er trug die Stiefmütterchen wie einen Werkzeugkoffer. Für ihn gab es da keinen großen Unterschied. Er war sich nicht einmal sicher, ob es überhaupt Stiefmütterchen waren. Diese ganzen verdammten Namen konnte sich doch kein Mensch merken. Sahen doch eh alle gleich aus, diese Blumendinger. Er hatte sogar für kurze Zeit vergessen, dass es Blumen waren. Tief in seinem Inneren glaubte er immer, egal was er in der Hand hielt, seine Schraubschlüssel und Bohraufsätze darin zu spüren. Das hatte sich in all den Jahren so eingeprägt. Sowieso, dachte er, liegt beides ziemlich nahe beieinander, denn warum werden Balkonblumen denn auch immer in diesen Zehnerplastepacks mit Henkel oben dran verkauft, und überhaupt wird das doch nur gemacht, um die Pflanzen vor ihrem Tod noch loszuwerden. Sind doch viel zu klein. Und gehen immer ein, die Dinger.
Die Dinger wippten mit ihren Köpfen.
Die Dinger wippten mit ihren Köpfen ebenso wie der kleine Schnurrbart, der unter der großen fleischigen Nase des Mannes hervor wuchs, beides wippte unter dem Erdbeben seines festen, behäbigen Laufschrittes, beides wippte irgendwie betrübt.
Zu Hause würde er die verdammten traurigen Dinger seiner Frau auf den Küchentisch knallen und sagen: „Da.“ Ja, das würde er tun.
Jetzt blickte er nach unten, wie er es immer tat, jeden verdammten Tag, wenn der Weg zu vertraut war, wenn er einfach nicht sehen wollte, wie Schritt für Schritt sein Spaziergang sich dem Ende neigte. Die an seinem Arm baumelnden Stiefmütterchen gerieten in gleichmäßigen Abständen immer wieder in sein Sichtfeld. Ein paar bunte verwischte Farben. Beton. Verwischte Farben. Beton. Farben. Beton. Farben. Beton. Farben. Beton. Er überquerte die Straße. Neben ihm ein Fahrrad. Er blickte kaum auf, nickte trotzdem kurz mit dem Kopf und grüßte die Briefträgerin. Auf die Minute genau. Wie jeden Tag. Er erkannte sie immer an ihren Schuhen. Heute waren es die blauen, aus Stoff. „Na?“ „Danke, gut.“
Farben. Beton. Farben. Beton. Farben. Langsam nervte es ihn gewaltig. Er zwang seine Hand, ruhig zu halten. Es klappte nicht. Farben. Beton. Farben. Beton. So eine Scheiße, dachte er. Immer dasselbe. Immer schickt sie mich los, um diese Dinger zu kaufen. Jedes Mal wieder.
IV