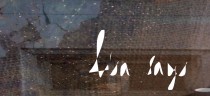Vor der Tür (innen).
Das Treppenhaus ist ein Ort, den es nicht gibt. Er ist eine Station, wo nichts hält. Es wird ausgeblendet, verschwiegen, verdrängt. Ein Ort, an dem nichts geschieht und nichts geschehen ist. Nicht existent, wie jeder, der sich hinein begibt.
Am Anfang ging die Tür immer sehr schwer. Man musste sich dagegenstemmen, auflehnen gegen sie mit aller Macht und Kraft, um danach erschöpft in sie hineinzustürzen. Heute fällt sie fast auf, ganz leicht. Ihr Widerstand ist gebrochen, die Jugend vorbei, geregeltes Mittelmaß mit dem Hang nachzugeben, bevor überhaupt jemand kommt. Unsere Tür ist ein ehemaliger Rebell. Kaputtes Wesen. Die verkörperte Tragik der Dinge. Ein Schicksal unter vielen. Man muss sie hinter sich schließen, von allein fällt sie nicht ins Schloss. Apathisch steht sie meistens offen. Niemand kümmert sich um sie, einfach ein Hindernis weniger, ein kleines Detail, das untergeht. Ihr gebrochener Wille ist eine willkommene Erleichterung, es ist nicht mehr nötig, die Tür aufzuschließen oder auch nur die Klinke zu betätigen. Es ist, als wäre sie einfach nicht da. Sie macht sich unsichtbar, passt sich an, jedoch nicht den anderen Türen, sondern dem Willen ihrer Benutzer. Denn wer hat schon noch Zeit, eine Tür zu öffnen. Drehtüren, Schiebetüren, Drehkreuze, Fahrstuhltüren, Supermarkttüren – von allein aufschwingende Türen. Sie ist hinterher. Doch ihr fehlt deshalb auch der Mechanismus. Sie kann sich auf nichts anderes verlassen, als auf sich selbst. Sie erwartet gesteuert zu werden, wie alle anderen, aber kein Bewegungssensor nimmt sich ihrer an. Und deshalb schaukelt sie nur ziellos in ihrem Rahmen, verwirrt, verbittert, ausgeleiert.
Sie ist ein Opfer und ein Täter unserer Zeit, die wir nicht haben.
Das Treppenhaus lässt keinerlei Anzeichen auf Benutzung erkennen. Es riecht stets frisch wie am ersten Tag, fremd wie am ersten Tag, unmenschlich wie am ersten Tag, es riecht nach der Verwesung des Stillstands. Kein Leben, der süßlicher Zitrusduft wie man ihn sonst nur in Hotels und fremden Wohnungen wahrnimmt, hatte es vertrieben. Und die Bewohner gaben sich keine Mühe dies zu ändern, vielleicht bemerkten sie es nicht einmal. Keine Spuren zu hinterlassen, heißt, nicht da zu sein, nie da gewesen zu sein, nicht zu existieren, faktisch tot zu sein. Es war egal. Es war den Rentnern egal. Es war der jungen Frau und ihrem kleinem Kind egal. Es war Herrn Pohl egal. Seinem kleinen Kläffer war es nicht egal, aber er konnte nichts anderes tun, als jeden Morgen um die gleiche Zeit erbärmlich zu jaulen. Das war alles. Sonst Stille. Man ist einander nie begegnet. Die Namen an den Klingelschildern lösen nichts aus. Bitte halten sie Abstand, um die Diskretion zu wahren. Maier. Müller. Hoffmann. Pohl. Aneinandergereihte Buchstaben in verschiedenen Etagen. Natürlich gibt es Erzählungen. Spekulationen. Gerüchte. Sie sind Phantome, gerade so interessant, dass man um ihr Dasein weiß, ohne die Last auf sich zu nehmen, zu forschen, ob es sie wirklich gibt. Es ist egal. Wir Leben aneinander vorbei, in dankbarer Anonymität. Keine Belastungen. Kein lästiges Grüßen. Keine falsche Freundlichkeit, kein aufgesetztes Interesse. Eine Bürde weniger.
Irgendwann doch eine Last, man wird sich voreinander verstecken, Angst, die eingelebte Ordnung zu stören.
Betritt man es endgültig, so ist man genötigt, die Tür hinter sich zu schließen. Man fühlt sich beobachtet, die sonst lässige Unachtsamkeit verwandelt sich unter mechanischen Augen zur größten Penibilität. Es ist niemand da, es riecht als wäre nie jemand da gewesen, verstörend neu. Und genau dies ist es, was verwirrt und einem das Gefühl gibt, dass etwas nicht stimmt. Dass man beobachtet wird. Es ist niemand da. Stille. Versuche, die Tür unsäglich leise zu schließen, es klingt wie ein Donnern. Auf dem Weg nach oben gibt es nicht viel zu sehen. Die sonst üblichen ausgemusterten Grünpflanzen, die sonst auf jedem Absatz jeder Plattenbaute zu finden sind, fehlen. Keine Schuhe vor den Türen. Keine Namensschilder aus Messing, sonder solche aus Plaste, die neben der Tür hängen und alle gleich aussehen. Das gesprenkelte Grau des Linoleums wirkt klinisch desinfiziert. Die Fußmatten darauf sind alle alte Bekannte, jede hat man schon einmal irgendwo gesehen, bei Aldi, bei Ikea, wer weiß das schon. Man hat keine andere Wahl, als auf den Fußboden zu starren, die Wände sind weiß und bedrohlich, zwingen, den Blick abzuwenden, Demut, Unterlegenheit, Ekel. Einzig das Licht strahlt eine gewisse Wärme aus. Steigt man höher, wird es immer kälter. Es fängt an zu flackern. Nicht oft oder schnell hintereinander, sondern für gefühlte Sekunden. Es ist kein Blitz mehr sondern erzeugt das Gefühl, ungewöhnlich lange geblinzelt zu haben, ein kurzer Schlaf, eine Ohnmacht, eine vorübergehende akute Blindheit.
Wenn das Licht unerträglich kalt geworden ist, bin ich zu Hause.
Das Treppenhaus ist ein Ort, den es nicht gibt. Er ist eine Station, wo nichts hält. Es wird ausgeblendet, verschwiegen, verdrängt. Ein Ort, an dem nichts geschieht und nichts geschehen ist. Nicht existent, wie jeder, der sich hinein begibt